
Biofuels Schweiz ist der offizielle Verband der Schweizerischen Biotreibstoffindustrie und vertritt die Interessen der Gesamtbranche und der Mitglieder gegenüber Behörden, Politik und Marktteilnehmern.
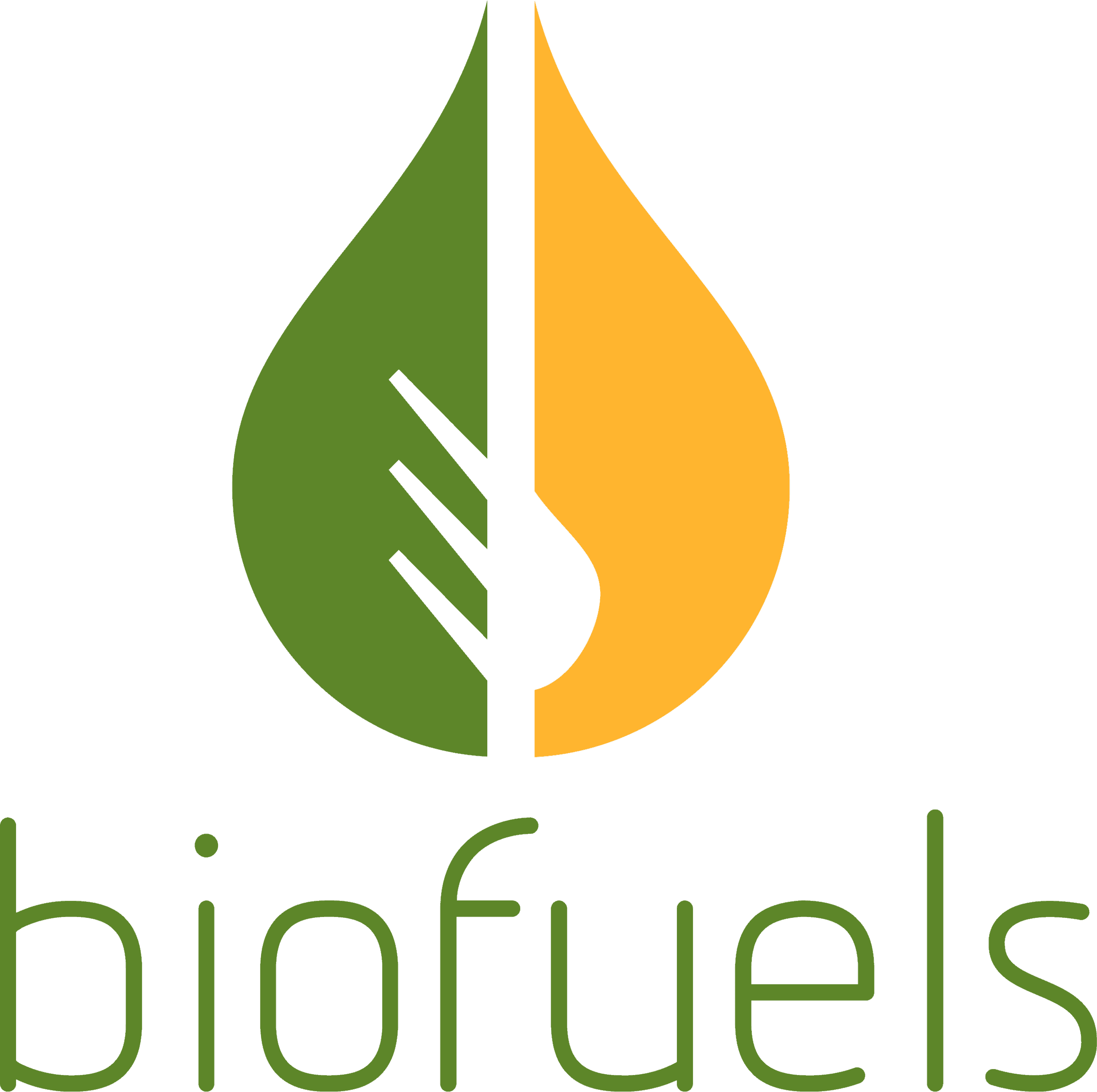
Biofuels Schweiz
Schweizerischer Verband der Biokraftstoffe
Bahnhofstrasse 9
CH-4450 Sissach